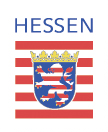Konfliktthemen

Der Anflug und der Stromtod (insbesondere von Großvogelarten) an Freileitungen stellen zwei Problemkreise dar, an dem die Staatliche Vogelschutzwarte schon lange arbeitet.
Verminderung des Anfluges an Freileitungen
Weil alljährlich Abertausende von Vögeln durch Anflug (Vogelschlag) zu Tode kommen, untersuchten wir bis 1997 in einem dreijährigen Forschungsvorhaben "Vogelverhalten an Hochspannungsfreileitungen" mit vielen Partnern die Ursachen für diese Unfälle und entwickelten auf der Basis der bei europäischen Vogelarten vorhandenen optischen Signale (Kontraste in der Gefiederfärbung) Markierungssysteme zum frühzeitigen Erkennen der Seile in der Luft. Parallel ließen wir durch ein Planungsbüro im Auftrag der RWE das gesamte Leitungsnetz dieses Stromunternehmens (11.000 km!) auf vogelschlagriskante Abschnitte untersuchen.
Inzwischen werden mit Hubschraubereinsatz die neu entwickelten Vogelmarker in diese Leitungsabschnitte eingebaut. Untersuchungen an Probeabschnitten haben ergeben, dass durch diese Markierungen das Vogelschlagrisiko um 90% reduziert werden kann. Wir empfehlen zu diesem Thema die Lektüre unseres "Vogel und Umwelt"-Sonderheft "Vögel an Freileitungen".
Maßnahmen gegen Stromtod
Die Masten von Mittelspannungsleitungen werden sowohl im Brut- wie im Durchzugsgebiet von vielen Vogelarten, von den Störchen über die Greifvögel bis zum Uhu, gerne als exponierte Aussichts- und Ruheplätze genutzt. Wenn diese Arten mit ihrer großen Flügelspannweite die Spannungspotenziale überbrücken, kommt es häufig zum tödlichen Stromschlag oder Stromschluss.
Obwohl seit vielen Jahren die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW e.V.) zusammen mit Natur- und Umweltschutzverbänden Empfehlungen zum Vogelschutz an Freileitungen herausgegeben hat, die von Netzbetreibern umgesetzt werden, existieren immer noch zahlreiche gefährliche Masttypen ohne Vogelschutzeinrichtungen. Mit der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 53 BNatSchG NeuregG) vom 25. März 2002 bzw. der Neufassung (§ 41 BNatSchG) vom 1. März 2010 sollen innerhalb von zehn Jahren d.h. bis zum 31. Dezember 2012 Masten und technische Bauteile mit hohem Gefährdungspotential so ausgerüstet oder konstruiert werden, dass Vögel gegen Stromschlag geschützt sind. Um diese Maßnahmen möglichst zielorientiert umzusetzen, erarbeiten wir für die Netzbetreiber Karten mit Darstellung der Vorkommen der relevanten Großvogelarten. Auch legten wir gemeinsam die geeignetsten Absicherungsmaßnahmen fest, die von Abdeckhauben und Schlauchisolierungen bis zu Sitzstangen (-"brettern") in Schwarzstorch-Revieren reichen.
Der Vogelanflug an Glasscheiben ist ein klassisches Vogelschutz-Problem. Insgesamt dürften in unserem Zuständigkeitsbereich jährlich schätzungsweise mehr als eine Million Vögel an Glasfassaden umkommen. Insofern beraten wir hier gerne, um Bauherren und Architekten, um den Vogelanflug an Glasfassaden wirksam zu reduzieren. Folgende Informationen (angelehnt an ein Merkblatt der Schweizer Vogelwarten-Kollegen) vorab: Glas ist eine doppelte Gefahrenquelle.
- Es reflektiert die Umgebung: Bäume und Himmel spiegeln sich und täuschen dem Vogel einen Lebensraum vor.
- Es ist durchsichtig: Der Vogel sieht nur die Pflanzen hinter dem Glas und nimmt das Hindernis davor nicht wahr.
Je weniger durchsichtige bzw. spiegelnde Flächen verbaut werden, umso geringer die Anflugproblematik.
Schutzmaßnahmen vor dem Baubeginn:
Bevor Glas an Stellen geplant ist, an denen es eine Gefahr für Vögel bilden könnte, sind folgende Überlegungen anzustellen:
- Muss es wirklich durchsichtiges Glas sein?
- Muss es eine transparente Konstruktion an exponierter Lage sein?
- Kann die Glasfläche reduziert werden?
- Würde auch eine mobile Vorrichtung, die nur im Bedarfsfall aufgestellt wird (z.B. Windschutz), reichen?
- Wo wird die Kollisionsgefahr am größten, und wie kann man ihr vorbeugen?
- Möglichst keine Über-Eck-Verglasungen
Folgende Alternativen sind zu nutzen:
- Vogelschutzglas (noch in Erprobung, bisher keine befriedigende Lösungen)
- Geripptes, geriffeltes, mattiertes, sandgestrahltes oder geätztes Glas
- Milchglas, Kathedralglas, Glasbausteine
- Mit Sprossen unterteilte Fenster
- Andere, undurchsichtige Materialien
- Oberlicht statt seitlicher Fenster
- Fenster neigen statt im rechten Winkel anbringen
Nachträgliche Schutzmaßnahmen bei bestehenden Gefahrenquellen
Nur eine flächige, sich möglichst von der Umgebung abhebende Markierung bringt den nötigen Schutz. Am besten bewährt haben sich senkrechte Streifen, die etwa 2 cm breit sind und im Abstand von höchstens 10 cm zueinander angebracht werden (sog. "Bird stripes" scotch magic tape 810, auch einfache schwarze oder weiße PVC-Klebebänder).
Einfach aber wirkungsvoll
- Gardinen, Jalousien, Dekorationen, Firmensignale etc.
- Möglichst fassadenahe, dichte Begrünung
- Rote bzw. gelbe Kunststoff-Reflektoren (Wildreflektoren, Durchmesser 6 cm) frei vor Fenster gehängt, so dass sie sich drehen, können Glasanflüge wirksam reduzieren
- Futterhäuschen und Nistkästen möglichst nicht in Fensternähe anbringen
Um Kollisionen weitgehend zu vermeiden, müssten Scheiben flächig markiert oder durch alternative Materialien ersetzt werden. Völlige Transparenz und Vogelschutz sind leider unvereinbar.
Den aktuellen Wissenstand zum Vogelschutz an Glasfassaden haben die Schweizer Kollegen der Vogelwarte Sempach in umfassenden Veröffentlichungen mithilfe von vielen Bildern und Beispielen zusammengefasst. Diese finden Sie hier: https://vogelglas.vogelwarte.ch/
In weiten Teilen Europas haben die Vögel in der Agrarlandschaft in den letzten Jahrzehnten starke Bestandsrückgänge hinnehmen müssen, wobei der Rückgang vielerorts noch immer anhält, wie die Feldvogelindizes von Europa, Deutschland und Hessen eindrucksvoll belegen. Für die Feldlerche wurde beispielsweise bundes- und hessenweit ein Rückgang von rd. 50 % in den letzten 12 Jahren detektiert. Dabei ist es vor allem die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung (z. B. durch Verschmälerung von Wegsäumen, Vergrößerung von Feld-/Schlaggrößen, Pestizideinsatz), die als Hauptursache für diese Bestandsrückgänge anzusehen ist.
Grünlanderhalt und -optimierung
Die Förderung erneuerbarer Energien hat zudem in den letzten Jahren dazu geführt, dass die Anbaufläche für Energiepflanzen enorm gestiegen ist und auch noch weiter steigen wird. Neben bekannten Kulturpflanzen wie Mais oder Raps kommen dabei auch unbekanntere Arten wie z. B. das Riesen-Chinaschilf zum Einsatz, deren Effekte auf Feldvögel oft noch nicht bekannt sind.
Durch diese veränderte Nachfrage nach Energiepflanzen geht auch eine Veränderung in der landwirtschaftlichen Fruchtfolge und Nutzung einher, die sich wiederum auf die Tier- und Pflanzenwelt im Offenland auswirkt. Monokulturen reduzieren das Vorkommen von Arten um mindestens ein Drittel gegenüber Fruchtwechseln. Diese Monokulturen oder damit verbundene verengte Fruchtfolgen finden sich jedoch oftmals im Anbau von Energiepflanzen wieder. Auch die z. T. vorzeitige Nutzung von Getreide zur Ganzpflanzensilage kollidiert mit den Brut- und Setzzeiten zahlreicher Tierarten, so dass hier auch nachteilige Effekte auf die Tierwelt zu erwarten sind.
Was für die einen Arten nachteilig ist, begünstigt andere. So nutzen Gänse und Schwäne die sich durch den vermehrten Anbau von Winterraps und Wintergetreide ergebende Nahrungsressource als Winternahrung und werden so – aus Sicht der Landwirtschaft – zu „Schadvögeln“ (siehe „Schadvogelgutachten Rheinland-Pfalz“ und „Gänsemonitoring Wetterau“).
Und die Nachfrage nach Energiepflanzen führt auch zur Umwandlung von Grünland zu Ackerland und somit zu einer Gefährdung der Wiesen bewohnenden Arten, insbesondere der ohnehin bedrohten Feuchtwiesenbewohner. Hier muss alles unternommen werden (insbesondere Grünlanderhalt und -optimierung durch Wiedervernässung und großflächige Beweidung), um die Situation der Wiesenvögel nicht zu verschlechtern (siehe Studie „Grünland und Weiden – Augenweiden in Hessen“).
Downloads
Projektsäule „Grünland und Weiden: Augenweiden in Hessen“
Durch die Errichtung von Windkraftanlagen können Rastgebiete verloren gehen. „Windkraftsensible“ Vogelarten können an Windkraftanlagen als Schlagopfer auftreten. Die Vorkommen und Verbreitung von „windkraftsensiblen“ Vogelarten müssen daher bei der Planung und Errichtung von Windrädern Berücksichtigung erfahren. Mit dem voran schreitenden Ausbau der Windenergie stellt insbesondere das Kollisionsrisiko für den Vogelschutz ein zunehmendes Problem dar. Bei seltenen Arten können die Verluste an Windkraftanlagen eine Gefährdung lokaler Populationen darstellen. Aber auch unabhängig davon, können die Verluste einzelner Individuen, eine Verwirklichung der artschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG bedeuten.
Die deutschen Vogelschutzwarten haben daher ihre Positionen als "Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten" auf der Website der Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten zusammengefasst:
http://www.vogelschutzwarten.de/windenergie.htm
Hier finden Sie auch die Vorgaben und Empfehlungen aller Bundesländer (und auch unseres Zuständigkeitsbereichs) in Form von Leitfäden.
Downloads
In vielen mitteleuropäischen Städten haben sich halbwilde Populationen verschiedener Gänsearten etabliert. Besonders im Fokus der Öffentlichkeit steht die Nilgans (Alopochen aegyptiaca). Als invasive Art breitete sie sich in den vergangenen Jahrzehnten über die Niederlande und Nordrhein-Westfalen weiter nach Südosten aus. Die Besiedlung des Rhein-Main-Gebiets erfolgte innerhalb der vergangenen 20 Jahre. In den Städten dringt sie weiter in den Siedlungsbereich vor als andere Gänsearten. Bedingt durch ihre raue laute Stimme und ein aggressives Revierverhalten haftet ihr in weiten Teilen der Bevölkerung ein negatives Image an. Städtische Erholungsflächen wie Parks und Grünanlagen werden von ihr bevorzugt zur Nahrungssuche oder als Rastplatz aufgesucht. Bei größeren Gruppen kommt es – wie bei anderen Gänsearten auch - schnell zu einer starken Verkotung der betreffenden Flächen. Zunehmende Beschwerden aus der Bevölkerung sind die Folge.
Wirkung von Lenkungsmaßnahmen auf die Gänsepopulation im Frankfurter Ostpark (2018)
Wirkung von Lenkungsmaßnahmen auf die Gänsepopulation im Frankfurter Ostpark (2019)